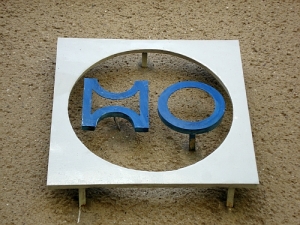You are currently browsing the category archive for the ‘Region’ category.
Nicht immer wird die Klischee-Kiste zu Ostdeutschland mit großem Bohei und als Leitartikel aufgestoßen. Manchmal schleicht sie sich auch als kleine Spitze in den Einstieg eines solchen. Den jeweiligen JournalistInnen ist gar nicht viel vorzuwerfen, außer vielleicht, dass sie der Dramaturgie und Zuspitzung wegen ein staubiges Vorurteil in der Welt halten.
Der gebürtigen Münchnerin (im Fall dieses Weblogs sind solche Details nicht unerheblich, denn eine gebürtige Wriezenerin hätte möglicherweise andere erste Zeilen gefunden) Christiane Schlötzer von der Süddeutschen Zeitung eröffnet ihr Seite Drei-Porträt des gebürtigen Sulzers, späteren CDU-Politikers und aktuellen Staatssekretärs Hans-Joachim Fuchtels mit einer bemerkenswerten Erinnerung an die Zeit, als man Ost und West noch in Schwarz und Weiß wahrnahm. Hans-Joachim Fuchtel operiert derzeit im besonderen Auftrag in Griechenland, nachdem er dereinst Brandenburg in Schwung brachte. Und entsprechend setzt man in den „Merkels Geheimwaffe“ betitelten Text mit einer bestechend finsteren Erinnerung ein:
„Der Mann hat eine Ringkämpfer-Statur, weshalb man ihm so viel Empfindlichkeit erst einmal gar nicht zutraut. Angela Merkels Spezialagent für das Atmosphärische hält die Nase in den Nachtwind und schnuppert Vertrautes. „Frankfurt Oder“, sagt Hans-Joachim Fuchtel. „Braunkohle“. Ein stechender Geruch liegt in der schwülen Luft. Die Erinnerung trägt den schweren Mann fort. Damals, sagt Fuchtel, als fast der ganze deutsche Osten noch ein Sanierungsfall war, habe er sich einen Tropfen Heilpflanzenöl aufs Oberlippenbärtchen geträufelt, wenn er im märkischen Kohlerevier unterwegs war. Dann war der böse Gestank weg.“ (Christiane Schlötzer: Merkels Geheimwaffe. In: Süddeutsche Zeitung, Nr. 162, 16.Juli 2012, S.3)
Freilich muss der Vorwurf an Christiane Schlötzer weniger sein, dass sie Despektierliches über Ostdeutschland präsentiert, sondern dass sie mit ihrer kleinen bissigen Bloßstellung den Mann der „weiß, was Spott ist“ (so die alberne Unterschrift zum nicht unbedingt perfekten Foto des Politikers, der in wirklich keiner Hinsicht an einen Ringkämpfer gemahnt) wie einen schlachtreifen Bullen in die Stierkampfarena führt. Die ölige Überheblichkeit hinter der Anekdote macht den Sanierungshandlungsreisenden („Net schwätze, schaffe.“) in einer Weise zum unsympathischsten Politiker des Tages, dass er einem schon beinah wieder leid tut, mit seiner übersensiblen Nase, die offensichtlich nur sauberste Schwarzwälder Morgenluft zu wittern gewohnt war, und seiner barthaarigen Fehleinschätzung, Frankfurt/Oder gehörte zum Kohlerevier der Mark.
Viel Kohle ist dort trotz aller Erschließungs- und Sanierungsanstrengungen bis heute kaum zu holen. Wenn man nun im Nachhinein dank Süddeutscher Zeitung erfährt, wer unter anderem zum Aufbaukampf in den Gestank des deutschen Ostens geschickt wurde, staunt man ein bisschen weniger darüber, dass die Transformation der sozialistischen Bezirksstadt zu einer Universitätsmetropole im Spätkapitalismus nicht in jeder Hinsicht perfekt verlief. Oder aber, dass sie überhaupt soweit gelang.
Frankfurt/Oder ist heute eine sympathische kleine Stadt mit sauberen Straßen, herzlichem Kleist-Gedenken, einer frischen Brise überm Grenzfluss und einigen äußerst klugen Köpfen in der Viadrina und damit gar nicht so schlecht aufgestellt. Wirtschaftlich hebt die Region allerdings nach wie vor eher nicht ab. Dennoch wünscht sich natürlich niemand irgendeine alte Zeit zurück. Und die Tage, in denen Sulzer japanische Heilöltröpfler auszogen, um statt zu schwätze zu schaffe und also mit Tat und Rat den Westen im Osten zu entfalten, zählen unbedingt dazu.
Für die ARD-Doku bricht Erich Honeckers Ehefrau Margot Feist nach Jahrzehnten ihr Schweigen. Höchst interessant. Leider kann man den Menschen nicht in den Kopf schauen, um herauszufinden, ob sie selbst das glauben, was sie sagen. Aber anhand des Gesagten merkt man schon, in welcher Gedankenwelt der Sprecher lebt. Margot Honecker ist sich keinerlei Fehler bewusst, wie viele alte Genossen auch.
Das Land heute ist nicht allein geteilt in Ost und West, sondern der Osten ist auch geteilt in Ostaliger und Menschen, die nach vorne schauen. Achtet mal darauf, was die Menschen bei Familienfeiern etc. so über die DDR sagen und versucht zu verstehen, warum sie das sagen. Es scheint mir, dass es so viele Deutsche Demokratische Repliken gab, wie die DDR Bewohner hatte.
Ein typisches Beschreibungsmerkmal für Ostdeutschland ist der Plattenbau. Kommt ein Journalist in den Osten, landet er sogleich in monotonen Plattenbausiedlungen, meist völlig verwahrlost oder halb abgerissen. Mal davon abgesehen, dass es im Westen ebenfalls Plattenbauten und im Osten mittlerweile großflächig sanierte Altstädte gibt, kann man zwischen all dem Beton auch so einiges entdecken. Martin Maleschka zieht mit der Kamera durch ostdeutsche Neubaugebiete und hält etwas fest, das man dort nicht vermutet hätte: Kunst. Die Regelungen der DDR zur Kunst sahen vor, ein bis zwei Prozent der Bausumme für die künstlerische Ausgestaltung zu verwenden. Neben propagandistischen Wandbildern mit Friedenstaube und sozialistischem Händeschütteln entstanden so auch futuristische Formsteinwände und hypermoderne Fassaden; hinzu kamen freistehende Bronze- und Steinskulpturen.
Martin, du bist in Eisenhüttenstadt aufgewachsen. War es dadurch für dich eine Selbstverständlichkeit, sich mit der Kunst und der Architektur der DDR zu beschäftigen? Wie kamst du zur Kunst am DDR-Bau?
Nein, es ist keine Selbstverständlichkeit. Das ist zu einfach gedacht. Wäre es das, würde sich jeder Gleichaltrige aus Eisenhüttenstadt für die Kunst in der Stadt interessieren. DDR-Kunst – vor allem Kunst am Bau, die mich interessiert – gibt es nicht nur in Eisenhüttenstadt, sondern auch in jeder noch so kleinen Ortschaft in Ostdeutschland. Ich denke, es ist vielmehr ein Aufeinandertreffen von verschiedenen Einflüssen verschiedener Leute und Bedingungen zu unterschiedlichen Zeiten. Es fing in meiner Jugend an. Ich interessierte mich für Kunst, Grafik, Malerei, Typographie und Graffiti. Graffiti war auch der Ursprung. Man könnte sagen: Versteht man Graffiti als Kunst am Bau, versteht man auch meine Passion für die Kunst am Bau der DDR.
Wie erklärt sich deine Vorliebe für den Plattenbau?
Ich bin den größten Teil meiner Jugend im Neubaugebiet des Wohnkomplex VII aufgewachsen. Damals war es für mich Wohnraum, den ich schlichtweg zu akzeptieren hatte. Meine Eltern waren stolz über ihre große Plattenbauwohnung. Das war 1989. Auch heute wohne ich in einer dieser seriell gefertigten und spöttisch »Arbeiterschließfach« genanntem Bauten. Vorliebe würde ich es nicht unbedingt nennen, es ist vielmehr eine strukturelle Verbundenheit zur Bauweise. Die verschiedenen Plattenbautypen (P1, P2, WBS70, Typ Erfurt, Typ Halle usw.) und viele Bauwerke der Ost-Moderne sind auf einem Raster aufgebaut. Geometrie, Rechtwinkligkeit und strukturelle Ordnung spielen für mich die tragende Rolle. Auf Studienreisen allerdings habe ich nicht nur Plattenbausiedlungen in Ostdeutschland gesehen. Paris, Berlin (Gropiusstadt & Märkisches Viertel) und Wolfsburg (Detmerode & Westhagen) beispielsweise haben riesige Plattenbausiedlungen aus den 70er-Jahren.
Wie würdest du einem »Wessi« dein Interesse an der Kunst und Architektur der DDR erklären? Schließlich handelte es sich um eine sozialistische Diktatur.
Ich möchte keine politischen Aussagen dazu treffen. Die stetig wiederholenden Symboliken und Themen wie Friedenstaube, Fortschritt in der Technik, Lebensbaum, Harmonie, Baukran, Arbeiter und glückliche Familie sind für mich ein immer noch aktuelles Thema. Wer möchte keine Arbeit haben, und wer will nicht in einer glücklichen Familie aufwachsen? Als ich 7 Jahre alt war, fiel die ›Mauer‹. Ich war zu jung um die Auswirkungen des Sozialismus zu spüren und zu begreifen. Klar waren die Kunstwerke der frühen DDR der Spiegel der SED-Politik, aber das änderte sich zunehmend. Schaut man sich Werke aus den 80er-Jahren an, stellt man fest, dass Kindergärten, Schulen und öffentliche Gebäude mit Bild-Thematiken ausgestattet wurden, die unpolitisch waren. Geschichtlich betrachtet liegt mein Fokus auf den 60er und 70er-Jahren, denn mit dem Aufkommen neuartiger serieller Bauweise veränderten sich auch die Bedingungen für die Künstler, nicht nur was den finanziellen Aspekt anbelangt. Das schnell durchgeführte Wohnungsbauprogramm der DDR ließ keine Zeit für die eher aufwändigen ›Bauernbilder‹ der 50er-Jahre in Kaseintechnik, Sgraffito oder Intarsien. Geschaffen wurden Kachel- und Klinkerfassaden und viele, viele Strukturwände. Je mehr Zeit verstrich, desto einfacher und kostengünstiger wurden die Baumaterialien und desto weniger Geld wurde für Kunst am Bau bereitgestellt – ganz klar, dass das dem ohnehin schon immerwährenden Streit zwischen Architekten und Künstlern nicht milderte. Was für mich den Reiz ausmacht, sind genau diese Produkte der Unzufriedenheit der Architekten und Künstler. Und eben genau diesen Missstand gab es so in Westdeutschland nicht.
Welches Kunstwerk gehört zu deinen absoluten Favoriten? Wo, in welchem Wohnumfeld oder Gebäude würdest du wohnen wollen, wenn du einen diesbezüglichen Wunsch frei hättest?
Es gibt viele Kunstwerke, die mich auf den ersten Blick eher formal ansprechen. Aber auch Werke, bei denen mich die Entstehung und die Herstellungsweise anspricht. Es gibt Techniken, mit denen heute nicht mehr gearbeitet wird. Das elektrostatische Beschichtungsverfahren (Glaskreusel) zum Beispiel, wo feinster Glassplitt an die Wand ›geschossen‹ wird. Für dieses neuartige Verfahren mussten erst neue Geräte entwickelt werden. Ich favorisiere die abstrakten und ornamentalen Werke. Strukturwände finde ich in dieser Hinsicht interessant, da sich schon mit kleinster Änderung der Perspektive die Struktur und damit auch die Wahrnehmung verändern. Die Varianz zwischen offen&geschlossen, innen&außen und Licht&Schatten sind für mich entscheidend. (Hätte ich einen Wunsch frei, würde sich mein Wohnort jährlich ändern. Jedes Jahr in einer anderen ostdeutschen Stadt zur intensiven Dokumentation der noch vorhandenen Kunst am Bau. Ostdeutschland gefällt mir.)
Was sagt uns die Kunst am Bau/DDR trotz ihrer überholten Ästhetik im Hier und Heute? Was wünschst du dir, wie soll damit generell umgegangen werden?
Für mich ist die Ästhetik nicht überholt. In der Mode kehrt auch alles wieder. Peter Guth beschreibt dieses Phänomen in seinem Buch mit »Wandbildmüdigkeit«. Die Leute sind vielfach nur satt. Die SED glaubte damals, den Kunstgeschmack (sofern man welchen hatte) der Bürger zu kennen. Diese Kunst (bildende Kunst) musste man hinnehmen, ob man wollte oder nicht. Das Problem liegt im Umgang mit der heute noch vorhandenen DDR-Kunst. Der Staat, der diese Kunst in Auftrag gab, existiert seit mehr als 20 Jahren nicht mehr. Wer hat also die Entscheidungsgewalt? Ich habe auf meinen Fototouren schon oft erlebt, dass Hausmeister einer Schule die Speiseraum-Wandbilder mit Schweinchenrosa oder Hellgelb übertünchen durften. Vor allem aber ist die Frage der Instandhaltung von Kunstwerken in alter Technik schwierig.
Wie kommst du zu deinen Fotomotiven? Liest du dir die Standorte an oder machst du Stadtspaziergänge und überlässt die Entdeckung der Motive dem forcierten Zufall?
Beides. Ich durchforste alte Zeitschriften, Magazine und Bücher. Bildende Kunst, Architektur der DDR oder auch die Baukataloge der bildenden Kunst + Architektur. Einschlägige Literatur u.a. von Werner Durth und Bruno Flierl habe ich natürlich gelesen. Es gibt aber auch das ein oder andere kleine Bildarchiv im Internet. Ich stelle mir Karten am Rechner zusammen und reise mit dem Fotoapparat »bewaffnet « mit dem Fahrrad und der Bahn umher.
~
Fotos: Martin Maleschka (Martin Maleschka präsentiert seine sehr schönen Fotos für alle zugänglich auf der Bildrplattform Flickr unter dem Projekttitel Kunst am Bau / DDR.
Mehr Hintergrundinfos gibt es auch bei Projekt KUNST AM BAU in der DDR.)
Autor: Marcel Reich-Ranicki
Titel: Tante Christa, Mutter Wolfen. (Online)
Erschienen in: DER SPIEGEL, 14/1994, S. 194-197
über: Christa Wolf, ihre Rolle in der DDR und Ostdeutschland und irgendwie auch über ihr Buch Auf dem Weg nach Tabou (Köln: Kiepenheuer und Witsch, 1994)
Marcel Reich-Ranicki als Geistesgröße der alten und neuen Bundesrepublik zu bezeichnen, wäre eine maßlose Untertreibung. Als Doyen der Literaturkritik ist er nach wie vor jemand, der in jedem medialen Zusammenhang, in den er eintritt, sofort den Mittelpunkt markiert. Lange Zeit war er unangefochtener Patriarch des Geschmacksurteils. So streitbar und oft auch verletzend er dabei auftrat, so unzweifelhaft war seine Rolle als Meinungsführer, auch wenn seine fachlichen Urteile bei genauerer Betrachtung bisweilen von einer erschreckenden Indifferenz, starren Deutungsmustern und absoluten (Vor-)Urteilen geprägt waren (und sind). Und so viel er von der Literatur an sich verstand und versteht, so wenig lag ihm, wie man heute regelmäßig in der Rubrik Fragen Sie Reich-Ranicki der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sieht, an einem Blick, der seine Voranahmen ein wenig in Reflexion bringen konnte. Die Horizontlinien standen irgendwann fest und diese Mauer überlebte unter anderem auch das Jahr 1989.

Und der Zukunft abgewandt? Für Marcel Reich-Ranicki war die Welt von Hammer, Zirkel und Ährenkranz bereits am 4.11.1989 irreparabel entzwei. Dass Christa Wolf noch etwas anderes im Blick hatte, konnte er ihr 1994 nicht nachsehen.
Autor: Jens Bisky
Titel: „Meine Nazis“, „Deine Nazis“ – ein müßiges Spiel. Wie braun ist der Osten? Eine Debatte, die nicht vorankommen will. (Online)
Erschienen in: Süddeutsche Zeitung, 01.02.2012, S. 11
über: die Debatte zu den Wurzeln des ostdeutschen Rechtsradikalismus
I
Irgendwann in den 1980er Jahren liefen nach Schulschluss drei Fünftklässler in der sozialistischen Vorzeigestadt Eisenhüttenstadt von der POS V „Juri Gagarin“ durch den V. Wohnkomplex heim und unterhielten sich über die richtige Handhaltung beim „deutschen Gruß“. Sie waren bepackt mit Ranzen und Turnbeutel und stritten sich ein bisschen darüber, ob die Hand dazu über die Schulter nach hinten gebogen zu halten sei, wie einer es in einem Film gesehen haben wollte. Oder ob der rechte Arm kerzengerade schräg nach oben wegzustrecken sei, wie man es auf Fotografien aus einem Geschichtsbuch kannte. Zur Verdeutlichung blieb einer der drei Jungen, imitierte, was er vom Foto kannte und rief halblaut seinen Begleitern entgegen „Heil Hitler.“ Ein älterer Passant, der ihnen entgegen kam, sprang sofort auf den Jungen zu, lief hochrot an und brüllte: „Weißt Du überhaupt, was Du hier machst!“ Er griff ihn an der Jacke und wenig ruhiger ratterte er auf die drei verängstigten Burschen ein: „Welche Schule? Wie heißt hier? Das werde ich melden. Ich werde dafür sorgen, daß das Konsequenzen hat. Für solche wie Euch ist bei uns kein Platz!“

Hitler kaputt? Nur weil man etwas durchstreicht ist es noch lang nicht verschwunden. Bisweilen ist der Effekt sogar gegenteilig, nämlich dann, wenn das Geächtete als Gegenpol zum Etablierten von denen herangezogen werden kann, die sich im Etablierten nicht wieder finden. Zumal wenn allein schon die Anspielung genügt, um sehr viel Lärm zu schlagen.
♪♫ Wer schmeißt denn da mit Lehm? Der sollte sich was schäm‘! ♪♫♪
(Claire Waldoff-Astoria)
Autor: Roger Willemsen
Titel: Deutschlandreise (S. 69–73)
Erschienen bei: Eichborn Verlag, Frankfurt am Main
im Jahr: 2002
über: Frankfurt an der Oder
Zu Beginn eine Selbstoffenbarung. Roger Willemsen war mal so allgegenwärtig, dass man sich gezwungen sah, eine Meinung über ihn auszubilden. Willemsen polarisiert: entweder man mag ihn oder man mag ihn nicht. Ich mag ihn nicht. Um meine Meinung über ihn etwas zu objektivieren, frage ich in meinem sozialen Umfeld, was haltet ihr von Roger Willemsen? Alles Roger? »Deutschlands Vorzeigeintellektueller.« – »War der nicht mal mit Guido Westerwelle zusammen?« – »Quatsch, mit Sandra Maischberger.« – »Belletristik ist nicht so seins, aber seine Rezensionen lese ich gern, die kann er gut.«
Hier eine Rezension von mir, allerdings bezogen auf einen kleinen Ausschnitt aus der Deutschlandreise, Willemsens Buchreport von 2002. Das ist schon ein Weilchen her, aber es soll in diesem Blog auch um die Kontinuität gehen, den Osten in ewig gleichen Stereotypen und Vorurteilen darzustellen. Der besagte Abschnitt behandelt Frankfurt (Oder), und er behandelt die Stadt schlecht. Nun ist die Deutschlandreise ein sehr subjektives Produkt, wie bereits der erste Satz klarmacht: »Ich sitze im Zug und fahre weit weg.«
Roger Willemsen bereiste das Land als beobachtender Dichter und unterlag somit keiner journalistischen Sorgfaltspflicht. Allerdings unterlag dafür die Poesie, denn was da so aus seiner Feder floss, war äußerst schwarze Tinte. Die Äcker im Osten sind Narben in der Landschaft, der Boden im Hinterland der alten DDR sieht »sauer und grämlich« aus, die Oder mit ihren toten Armen ist »braun und schmuddelig«, die Häuser »gehässig renovierte Kleinodien«. Elke Heidenreich, die das Buch aus Zeitgründen vermutlich nur rasch überflogen hat, jubelt auf der Rückseite:
Eine grandios erzählte Reise ins Innerste eines Landes, das unser Land ist, bereist von einem Autor, der Klischees nicht auf den Leim geht…
Der Autor, der in Talkshows durchaus eloquent und intelligent auftritt, geht nicht auf dem Leim, er klebt förmlich. Meistens kämpft er mit der Sprache, ziemlich oft verliert er. Manchmal beschleicht einen das Gefühl, ein Schreibautomat, programmiert mit dem Vokabular der üblen Laune, habe den Text erscrabbelt. Zwischendrin schildert Willemsen einen Bordellbesuch, liest den Raubdruck eines obszönen Buches und erwähnt hie und da Worte wie »Sex«, »Porno« oder »Prostituierte«. Klar, der Leser soll bei der Stange (beim Stängel?) gehalten werden. Wer die Deutschlandreise liest, erfährt nichts über das Innerste von Deutschland, wohl aber einiges über das Innerste von Roger Willemsen (um 2002). Was hat nun der Dichter zur Stadt an der Oder zu sagen?
Frankfurt (Oder) ist da, eine dieser im Stich gelassenen Städte. Wenn nicht Manfred Wolke hier einen Boxstall unterhielte, wenn nicht der »SPIEGEL-TV«-Exportschlager »Grenzprostitution« dem Ort das Verruchte verliehe, was wäre Frankfurt (Oder)? Eine Stadt, über der die Dunstglocke des Asozialen hinge, der Geruch der Kleinbürger, ein Mahnmal für die »Verlierer der Einheit«.
Das gleich als Einstieg. Okay, der Mann ist in der (ehemaligen) Bundeshauptstadt Bonn zur Welt gekommen und hat in Florenz, München und Wien studiert. Frankfurt beleidigt da einfach nur das ästhetische Empfinden des Welterfahrenen. Es begrüßen ihn Kioskkultur, Dosenbier, Jogginganzüge und »George Grosz’sche Kleinbürger-Karikaturen« (selber!). Viel lieber hätte er mit Sophie Marceau auf dem Sofa gesessen und der Jazzmusike, die Herbie Hancock und Michel Petrucciani für ihn im Hintergrund spielen, gelauscht. Verständlich. Wie geht es weiter? Der Dichter wird dreist und schimpft über Kleist:
Muss man tot und bedeutend sein, um in Frankfurt/Oder so gut zu wohnen? Was dieser Kleist die Stadt gekostet hat, und zum Dank beherbergt er Ausländer und kriegt auch noch ein Denkmal. Oder eher einen Sarkophag samt einem lyrisch hingestreckten Bekränzten mit Leier ohne Saiten.
Was folgt, ist Genörgel und Geschwafel. Grundtenor: Alles schlecht. Angesichts dreier Angler am Oderufer stellt er sich und uns die nächstliegende Frage:
Wer wäre noch erstaunt, Menschen hier zu finden, die mit Handkantenschlägen Kaninchen schlachten?
Aha. Der Fairness halber muss gesagt werden, dass Roger Willemsen nicht nur Frankfurt (Oder) bzw. Ostdeutschland wenig ansprechend fand, sondern dass diese Sprache der rote Faden auf der ganzen Deutschlandreise ist/war. Mit so einem Griesgram möchte man keine drei Tage Urlaub machen, mit Ausnahme er bezahlt! Vom protestantischen Meer zu den katholischen Bergen – ganz Deutschland ist bei Willemsen ein düsteres Drecknest! Vielleicht lag’s am Reisemonat, vielleicht an mangelnder Triebabfuhr (das Sex-Thema zieht sich so durchs Buch), vielleicht ist der Text auch eine Anspielung oder gar Parodie auf etwas von Heine oder Brecht oder Ironie? Das habe ich mich oft gefragt und keine Antwort gefunden, weiß es auch heute nicht und muss nun gehen.
Als Fremder sucht man immerzu das Eigentliche, irgendetwas, was hinter allem ist, das Wesentliche, aber man kommt nur durch Fassaden und Tapetentüren.
Darauf möchte ich nur mit einem Zitat antworten: Niemand ist so blind, wie einer, der nicht sehen will. Guten Abend!
„Kein Sex, viel Bier, fast nur Männer, Musik und eine Menge komisches, oft rechtsradikales Geschwätz: Davon handelt dieser Bericht.“ – Wolfgang Höbel über Moritz von Uslars Deutschboden. (In: Wo Deutschlands wilde Kerle wohnen. Spiegel online. 02.10.2010)
Als Ergänzung zur Auseinandersetzung mit Moritz von Uslars Anklam-Bild bietet sich ein Blick auf dessen Buch Deutschboden. Eine teilnehmende Beobachtung. (Köln: Verlag Kiepenheuer & Witsch, 2010) durchaus an.
Der Klappentext beschreibt, worum es dem behuteten Reporter geht:
„Moritz von Uslar geht in eine Kleinstadt im Osten Deutschlands, er bleibt drei Monate und kehrt mit dieser großen Erzählung, einer Geschichte der Gegenwart, die gleichzeitig Reportage und Abenteuerroman ist, zurück.
Draußen, vor der Großstadt, wo Hartz IV, Alkoholismus, Abwanderung und Rechtsradikalismus angeblich zu Hause sind: Hier beginnt diese Geschichte. Der Reporter sucht nach einem Ort mit Boxclub und Kneipe und findet ihn im Landkreis Oberhavel, gut eine Autostunde nördlich vor Berlin. Pension Heimat, Franky’s Place, Gaststätte Schröder: Pils am Tresen, Diktiergerät am Mann. Der Reporter hört zu, guckt zu, trinkt mit, trainiert mit, labert mit, und am nächsten Morgen steht er wieder da. Es erscheinen der Kneipenchef Heiko, der Geschichtenerzähler Blocky, der tätowierte Punk Raoul, und damit ist der Zugang eröffnet: zu den Proben der Band »5 Teeth Less«, zu Grillfesten mit Deutschlandfahne, zum Abhängen am Kaiser’s-Parkplatz und an der Aral-Tankstelle – und zum Alltag junger Männer, die vielleicht keine großartige Zukunft haben, aber einen ziemlich guten Humor.
Die präzisen Beobachtungen, im Wortlaut mitgezeichneten Gespräche, die Gags, Sprüche, Märchen und Blödeleien und die Fülle absurder, rührender und furchterregender Alltäglichkeiten entwickeln einen Sog, der den Leser hineinzieht in das Leben in der ostdeutschen Kleinstadt. Das ist klassisches und das ist modernes Reportertum.
Moritz von Uslar besitzt den Mut, die Ausdauer und das Einfühlungsvermögen, um zu zeigen, dass Wirklichkeit immer jener Ort ist, der jenseits der Erwartung liegt. In diesem Buch ist Platz für allerhand Abstrusitäten, bloß für keine Trostlosigkeit. Deutschboden leuchtet – es ist das Licht der Tankstelle an der Ausfallstraße nachts um halb eins. „
Es hätte Eisenhüttenstadt treffen können, aber die wurde dem Autor durch die Bild-Zeitung bereits verübelt. (sh. dazu auch hier) In Schwedt kam er seinem ethnografischen Zielen schon näher, hatte aber in der „Boxsporthalle Günther Jähnke“ ein niederschlagendes Erlebnis (Sportunfall). Am Ende kam Zehdenick zu Ehren:
„Dieser Ort hat sich nicht durch besonders krasse Zustände ausgezeichnet, es ist ein schöner Ort. Überspitzt gesagt: Ich wollte nicht zwischen Plattenbauten warten, bis ich eins auf die Fresse kriege. Ich versuche, mich bewusst anders als der Reporter im Spiegel oder in der RTL-Sozialreportage zu benehmen. Ich stelle mich einfach hin, saufe und warte, wie sich die Dinge entwickeln. Das ist der absolute Luxus. Ich will über eine gewisse Stumpfheit, Getrübtheit der Wahrheit bewusst nicht hinaus. Was ich fantastisch finde, sind die äußere Ereignislosigkeit und die sprachliche Begabung der Leute.“ ( „Ich habe versucht, mich ein bisschen dumm zu stellen“ – Interview mit Moritz von Uslar. In: taz, 22.11.2010, S.16)
Und die Zehdenicker nahmen ihm die Wahl anscheinend gar nicht übel:
„Fühlt er sich verspottet? „Nein. Er muss ja unterhalten, sonst würde das Buch keiner lesen.“ Blocky lacht beim Lesen.“
So ermittelte Kolja Reichert für die WELT bei der Nachrecherche. (Moritz von Uslar – wo die wilden Kerle wohnen, 05.10.2010)
Nicht nur Felix Helbig hätte etwas anderes erwartet. Jedenfalls kam er in einer Nebenbemerkung in einem Artikel zu einem anderen – westdeutschen – Projekt dieser Art (Und eigentlich ist das ja alles ganz normal. In: Frankfurter Rundschau 13.08.2011, S. R8) zu dieser Einschätzung:
„Uslar hatte im vergangenen Jahr seinen schicken Altbau in Berlin-Mitte verlassen, um sich für drei Monate in einem Dorf in der brandenburgischen Provinz einzunisten und über die einfachen Menschen dort ohne deren Wissen eine „teilnehmende Beobachtung“ zu schreiben. Als das Buch „Deutschboden“ schließlich fertig war, fuhr er erneut hin und lud alle zur Lesung ins örtliche Bowling-Center ein. Das war dann die Geschichte von einem, der auszog, eins auf die Fresse zu kriegen. Bekam er zwar nicht, hätte er aber sehr verdient gehabt.“
Dabei schreibt von Uslar seine Texte doch aus Liebe. Jedenfalls arbeitete Susanne Messmer für die taz so eine Position aus „diesem großartigen Buch über Ost und West, Unterschicht und Upperclass, über Hartz IV und das Leben im Nichts, das auch ein Leben mit Existenzberechtigung ist“ heraus:
„Moritz von Uslar lernt die harten Exnazis mit den volltätowierten Supermuckis, vor denen er sich so fürchtet, nicht nur kennen. Er verliebt sich sogar in sie. Da heißt es in einem dieser schönen Uslar-Schachtelsätze: Konnte es sein, dass die Jungs eben weil sie ein Leben außerhalb des Konkurrenzdrucks und der Karrieren führten schon eine Stunde weiter waren? Konnte es sein, dass wir, die an dem abgelaufenen Konzept Selbstverwirklichung durch Arbeit festhielten, endlich anfingen, die Benachteiligten, die Randexistenzen der Gesellschaft als das zu sehen, was sie in Wahrheit wohl waren, keine Problemfälle, sondern die Mitte der Zukunft unserer Gesellschaft, die Avantgarde?“
Die Deutung ist nicht ohne Reiz und vermutlich auch nicht ohne Wahrheit, vielleicht aber dennoch ohne Tiefe. Ein wenig fragt man sich, wer hier eigentlich der Junge vom Land ist. Es ist gar nicht so sehr das Problem, dass Autoren wie Moritz von Uslar Ostdeutschland vor allem als provinzielles Skurrilien inszenieren, was Berliner Literaturwissenschaftsstudentinnen vermutlich auch in dem Glauben bestärkt, man könne pauschal von allem jenseits der Stadtgrenze als – O-Ton – ‚Flachwichserbrandenburg‘ sprechen.

Bereit für den Shellshock? „Ich will dahin, wo Leute in strahlend weißen Trainingsanzügen an Tankstellen rumstehen und ab und an einen Spuckefaden zu Boden fallen lassen!" schreibt Moritz von Uslar. Also zum Beispiel nach Kerpen. Da er zwar in Köln geboren ist, aber in Berlin wohnt, musste es - wohnortnah - eine Oststadt sein. Die fand er dann in Zehdenick und scannte diese ihm fremde Welt mit seinem Deutschbodenradar.
»In Anklam, dieser – so konnte man vielleicht sagen – kaputtesten, fertigsten, unseligsten Stadt Deutschlands.«
(Moritz von Uslar)
Autor: Moritz von Uslar
Titel: Freitagnacht in Anklam
Erschienen in: ZEIT ONLINE (www.zeit.de)
am: 10. Mai 2010
über: Anklam in Vorpommern
Chemnitz war noch Spaß, jetzt wird es langsam ernster. Im Frühjahr 2010 startete Moritz von Uslar seine Reihe »Nachtleben an den aufregendsten Orten der Welt« und machte den Auftakt in der 13.000 Seelen beherbergenden Gemeinde Anklam. Irgendwie scheint zwischen Anspruch und Wirklichkeit bereits in der Aufgabenstellung eine ziemliche Diskrepanz zu klaffen. Wer ist nun dieser Moritz von Uslar? DIE ZEIT stellt ihren Reporter in folgenden Worten vor:
Autor Moritz von Uslar hat seinen ersten Auftritt. Für seine Reihe »Freitagnacht« wird er Menschen an unterschiedlichen Orten beim Feiern beobachten. Diesmal war er in Anklam in Vorpommern. Uslar, 39, zuvor beim »Spiegel«, wurde bekannt durch die Serie »100 Fragen an…« im »SZ-Magazin«. Im Herbst erscheint sein Buch »Deutschboden. Eine teilnehmende Beobachtung«.
Ach so. Uslar ist einer dieser Ethnologen, die die mitteleuropäische Bevölkerung einer näheren Betrachtung unterziehen, mit den Eingeborenen leben und diese anschließend quasi von innen heraus beschreiben. Ein befreundeter Buchhändler in Berlin-Mitte verriet mir, das inzwischen erschienene Buch Deutschboden sei sehr unterhaltsam, lesenswert und verkaufe sich ganz gut. Aus der Wikipedia erfahre ich, dass Moritz eigentlich Hans Moritz Walther Freiherr von Uslar-Gleichen heißt. Seine flotte Schreibe – wie meine Oma sagen würde – lernte der geborene Kölner bei der seligen Zeitschrift Tempo sowie der Süddeutschen Zeitung und dem SPIEGEL. Auf den Fotos, die das Netz anbietet, wirkt er wie ein junggebliebener Libertin. Ist der Freiherr ein Freidenker?
Zurück zum Thema. Die Reportage-Reihe »Nachtleben« führte unseren Moritz über Längen- und Breitengrade. Auf Anklam folgte das Maxim’s in Paris, dann die Odenwaldschule, der Schlafwagen nach Zürich, das Dörfchen Guttenberg in Oberfranken, die Borussia Dortmund und Kairo in Ägypten – eine wilde Mischung! Doch warum ausgerechnet Anklam als Auftakt? Da kann doch nur die reine Schalkhaftigkeit des Wahl-Berliners durchgekommen sein! Billige Gags, dankbare Klischees und gängige Vorurteile sind so bereits vorprogrammiert.
Es zeichnete sich einer dieser grandios aufgeregten Berliner Abende ab (an der Friedrichstraße sollte die King Size Bar eröffnen, gegen Mitternacht würden die Gäste des Deutschen Filmpreises den Friedrichstadtpalast verlassen und wieder nicht wissen, wo sie weiterfeiern sollten, was immer für lustige Szenen sorgte) – als ich, gegen Mittag, den Entschluss fasste, diese Freitagnacht nicht in Berlin, sondern ganz woanders zu verbringen: in Anklam. In dieser – so konnte man vielleicht sagen – kaputtesten, fertigsten, unseligsten Stadt Deutschlands.
Wie die Einleitung verrät, wäre der Reporter an jedem Abend lieber in Berlin geblieben (miserable Ausgangsbedingung); und wie der Schluss verrät, wird er dort auch bald wieder landen. Nix von wegen teilnehmender Beobachter! Der Reporter, der sich auf die Suche nach der verlorenen Eastside macht, hat bereits nach wenigen Stunden die Hosen gestrichen voll. Er bekam Angst vor den Schattenwesen, die er selbst erschuf. Wieder daheim, im sicheren Berlin, erhebt sich von Uslar über seine Angst und beleidigt die Anklamer via Tastatur:
Ich, Reporter, wollte ja nicht viel – nur ankommen und die Leute, die da eventuell herumstanden, fragen, ob man hier noch irgendwo ein Bier trinken konnte. Meine Frage war: Was treibt ihr, Anklamer, wenn ihr, gegen alle Wahrscheinlichkeit, doch einmal gute Laune habt?
Lieber Moritz von Uslar! Als Hunter S. Thompson, der Erfinder des Gonzo-Journalismus, bei den Hell’s Angels an der amerikanischen Westküste recherchierte, lebte er immerhin ein Weilchen mit und bei den Acid-Rockern, bevor er dann allerdings wirklich übel zusammengeschlagen wurde. Das soll dir (ich bevorzuge das Du) natürlich nicht passieren! Aber wie kannst du dann so tun, als würdest du dich mutig unters Volk mischen, indem du den ausgelatschten Pfad des ostdeutschen Rechtsradikalismus betrittst, nur um mittendrin die Beobachtung abzubrechen, weil in dem von dir selbst ausgesuchten Rockerklub tätowierte Glatzen sitzen? Und soll der Leser aus deinen Worten schließen, dass man Anklam unbedingt umfahren sollte, weil die Stadt vollständig darnieder liegt und des Nachts von blutsaugenden Nazibanden durchkämmt wird, die sich vorher in einer Bierbar a la Clockwork Orange Mut ansaufen? (Zitat: »Wer Western und die Filme von Quentin Tarantino mochte, der konnte dieses Lokal nicht schlecht finden.«)
Ich würde sagen, Moritz von Uslar ist nie wirklich in Anklam angekommen. Uslar fremdelte gleich bei der Ankunft, huschte schnell mal durch die Straßen der Kleinstadt und spulte alle Vorurteile ab, die er sich zuvor schnell angelesen hatte und natürlich vor Ort bestätigt findet. Zum Vergleich könnte ich nun auch nach Köln fahren, das dortige Großbordell besuchen und anschließend schreiben: »Die Stadt riecht nach Schweiß, Sperma und Desinfektionsmitteln. In Köln bekommt nur Liebe, wer sie sich leisten kann.« Ha. Ha. Genauso gut könnte ich von Mallorca behaupten: »Die Insel besteht nur aus Ballermann 6, Sangría-Orgien und Ficken am Strand.« Beschreibt das die Insel? Nein.
Natürlich sollte man alles nicht so eng sehen, nicht so gemeint, mal über sich selbst lachen, der Uslar ist schließlich auch ein großer Freund der Ironie, et cetera bla bla. Allerdings ist schon auffällig, dass die nachfolgend besuchten Orte wie die Odenwaldschule oder das kleine Dörfchen Guttenberg vergleichsweise Milde davonkommen. Warum werden Ostdeutsche, denen man grundsätzlich Rassismus, Alkoholismus und Faschismus vorwirft, wieder einmal mit Vorurteilen beschrieben, die selbst rassistisch sind? Egal, schwamm drüber! Uslars Texte sollte man nicht auf die Goldwaage legen, denn dafür sind sie zu leicht. Ihm geht es vorrangig um den subjektiven Eindruck des Reporters, der dem Leser auf saloppe Weise verschiedene Orte des Planeten nahebringen soll – Unterhaltung eben, zurücklehnen. Erfreuen wir uns zum Ausgleich mal an dieser schönen Zeile:
Als sich der Reporter aus dem Saal schlich, sang der Schlagersänger gerade: »Vielleicht gestehe ich dir heute alle meine Liebeslieder.«
Auch wenn Ironie und Zynismus zwei verschiedene Paar Schuhe sind – bleiben wir großzügig! Es kann viel schlimmer kommen, warten wir es ab. Absolut empfehlenswert sind auch bei diesem Artikel die Kommentare. Da wurden Aussagen getriggert, die man in dieser Vielfalt sonst nie bekommen hätte. Vielleicht war es das, was die ZEIT-Redakteure wollten: Die Anklamer sollten endlich enger zusammenrücken! Anfangen möchte ich mit dem ortsansässigen Verein Initiativen für Anklam (IfA), der umgehend eine Eingabe an den Chefredakteur der ZEIT, Giovanni di Lorenzo, aufsetzte:
Sehr geehrter Herr di Lorenzo, wir, die IfA fühlen uns veranlasst, zum o.g. Artikel des Autors Moritz von Uslar Stellung zu nehmen. Natürlich liegt es uns fern, in Ihre journalistische Freiheit einzugreifen, wir möchten aber doch mit unseren Gedanken dazu nicht hinter dem Berg halten, denn wir sind auch der Meinung, dass ein Autor in einem geschätzten und meinungsbildenden Blatt wie der ZEIT nicht frei von Verantwortung ist. Verantwortung den Menschen gegenüber, über die er schreibt und die durch diesen Artikel wieder einmal in die negativen Schlagzeilen geraten sind. Es ist ein bisschen wie noch mal draufzuhauen, wenn jemand schon am Boden liegt. Hat DIE ZEIT das nötig? Wir sind ständig mit großem Engagement und persönlichem Einsatz darum bemüht, das Blatt endlich zum Besseren zu wenden, stoßen an Grenzen, kämpfen weiter und freuen uns über erste Erfolge, die bestätigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Dass das in einer Stippvisite von außen nicht gleich wahrgenommen wird, ist verständlich. Allerdings ist es verdammt schwer, mit solch einem Negativimage, was Anklam nicht zuletzt aufgrund verschiedener Presseveröffentlichungen anhängt, jemals wieder positiv wahrgenommen zu werden.
Freilich ist es einfach, in Anklam alle Klischees über eine Stadt im äußersten Nordosten Deutschlands bestätigt zu bekommen, die der Autor ganz offensichtlich mitgebracht hat.
Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass es ihm gerade darauf ankam. Zur bildhaften Darstellung des Verfalls in Anklam wird ein Archivfoto veröffentlicht, welches mindestens 5 Jahre alt ist. In dem gezeigten Haus befindet sich seit 2005 das erfolgreich geführte Einzelhandelsgeschäft „Mode am Markt“.
Der Kommentator Klein-Otti gibt sich als Insider zu erkennen und widerspricht Uslars Eindruck von der beschriebenen Bierkneipe:
in der genannten kneipe treffen jung und alt,linke,rechte, einwanderer aufeinander und in den 20-30 besuchen von mir hat niemand randaliert.
Der Kommentar von nordost2 enthält sogar einen gutgemeinten Ratschlag:
Ach Herr von Uslar, das ist langweilig. Derlei Artikel über Ostdeutsche Kleinstädte stapeln sich doch schon im Zeit-Archiv. Da hätten Sie auch nach Bernau oder Eberswalde fahren können und wären sicher noch rechtzeitig zu einer angesagten Party in Berlin zurückgewesen.
ReVaan kommentiert aus der Sicht des Exil-Anklamers:
Das der Ort und die Situation für jemand Außenstehenden trostlos, verwahrlost und sinnbildlich für die „Ach so verkommene Gegend Nordostdeutschland“ sein muss, kann ich akzeptieren und sogar verstehen. Die Situation mit den Rechtsradikalen nimmt langsam überhand und auch so kann man der immer schlimmer werdenden Notlage förmlich zusehen. Menschen verlieren ihre Arbeit, Läden schließen und das Äußerliche der Stadt wird immer schäbiger. Und trotzdem muss ich sagen, dass ich immer wieder gerne hinfahre (fast jedes Wochenende). Man hat dort seine Freunde, seine Familie. Es macht Spaß mit diesen dort etwas zu unternehmen auch wenn man nur begrenzte Möglichkeiten hat. Schade dass der Reporter sich fast nur Orte gesucht hat, die zwar zutreffend beschrieben sind, aber meines Erachtens nicht für Anklam als Ganzes gelten.
Wer noch etwas mehr Zeit in ZEIT online investieren möchte, dem sei der Kommentar-Mehrteiler von Johannah Rapunzel ans Herz gelegt. Sie antwortet sehr detailliert und wegen des Zeichenlimits der Kommentarfunktion in insgesamt zehn Teilen.
„Um drei Uhr nachmittags ist der große Platz gesperrt. In der Mitte unseres Plattenbauviertels wird ein gigantischer Supermarkt eröffnet. Endlich.“
Mit der Supermarkteröffnung, parallel zu einem vorbereiteten Bahnsuizid, eröffnet Andrea Hanna Hünniger ihr Erinnerungsbuch Das Paradies – Meine Jugend nach der Mauer über das Aufwachsen im Ostdeutschland der 1990er Jahre und in gewisser Weise tauchen die Elemente der üblichen Stereotypien bei ihr auch auf. Aber etwas ist doch anders. Die Autorin berichtet nicht aus der externen Perspektive, sondern aus ihrer Biografie. Daher gehört sie natürlich eher in die Kategorie Eigenwahrnehmung Ost.

Überall ist Supermarkt. In der Mitte der Plattenbauviertel: Einkaufszentrum in Hoyerswerda.
»Nur 20 Prozent aller Menschen haben ein Gespür für Ironie, was bedeutet, dass achtzig Prozent der Erdbevölkerung alles für bare Münze nehmen.«
(Douglas Coupland: JPod)

Karl Marx kann da nicht lachen.
Autor: Michael Gückel
Titel: Cui bono, Chemnitz? Vom einstigen DDR-Gulag zur Hauptstadt des Grauens.
Erschienen in: taz (www.taz.de)
am: 2.1.2012
über: Chemnitz
Gründe, dieses Weblog aus der Taufe zu heben, gab und gibt es genügend. Der eigentliche Auslöser war ein Artikel des taz-Genossen Michael Gückel: Cui bono, Chemnitz? Vom einstigen DDR-Gulag zur Hauptstadt des Grauens. Darin vergleicht der Autor das frühere Karl-Marx-Stadt mit Tschernobyl und bezeichnet den Karl-Marx-Kopf, kurz: Nischel, als verstrahlten Meteorklumpen. Um es gleich vorweg zu nehmen, denn das wurde nicht jedem sogleich klar, wie die meisten der 742 Kommentare beweisen: Alles nur Spaß! Erschienen ist der Spaß-Beitrag in Die Wahrheit, der Satire- und Humorseite der taz.de: »Die Wahrheit hat drei Grundsätze: Warum sachlich, wenn es persönlich geht. Warum recherchieren, wenn man schreiben kann. Warum beweisen, wenn man behaupten kann. Deshalb weiß Die Wahrheit immer, wie weit man zu weit gehen kann.«
Man kann den vorliegenden Artikel ganz gut als Parodie auf die herkömmliche Negativpresse Ost lesen, denn er enthält bereits viele wesentliche Elemente aus denen solche Beiträge sonst gestrickt werden. »Die Welt wird langsam blass und immer grauer, Chemnitz kann nicht mehr weit sein.« Bereits der erste Satz ist ein Paradebeispiel, weil er sich auch auf den Himmel bezieht, der wie immer grau ist, grau sein muss, denn man befindet sich in Ostdeutschland. Deutschland ist, bedingt durch die Wolkenmauer der Alpen, wahrlich keine Sonnenscheininsel, doch im Osten scheint sie nie zu scheinen, die Sonne, wenn Reporter dort unterwegs sind. Ex oriente krux.
Als nächstes sind die Plattenbauten dran, aus denen bekanntlich die gesamte ehemalige DDR errichtet wurde – im Westen gibt es so etwas ja nicht. Monotonie, wohin man sieht. Warum verfährt sich die Journallaie auch immer ausgerechnet in die Neubaugebiete? Gückel schreibt:
»In den Siebziger und Achtziger Jahren ging es weiter bergab mit den Karl-Marx-Städtern. Sie wurden Teil eines groß angelegten Versuchsaufbaus, bei dem die psychische Belastbarkeit der Bürger getestet wurde. Man transformierte die Stadt immer weiter in ein klobiges Plattenbaulabyrinth, das nur zwei Extreme kannte: kackbraun und aschgrau.«
Ein weiteres typisches Element sind die Gedenkkreuze für jugendliche Verkehrsopfer an den Straßenrändern, oft, allzu oft gesehen an Alleen in Branden- oder Mecklenburg. In meinen Augen war das vor allem ein Phänomen der Neunziger. Mich würde heute interessieren, wie viele Fälle davon Selbstmorde waren. Weil die Freundin weggelaufen ist, weil die Situation perspektivlos war, weil weil weil …
Die allseits unbeliebten Neonazis kommen in dem Satire-Beitrag merkwürdigerweise nicht vor, dafür gibt es ein Potpourri der ansonsten üblichen Schlagworte: Hartz-IV-Empfänger, Bevölkerungsschwund, Image-Kampagne. Auch über den sächsischen Dialekt und den Ortsnamen wird sich – zu akademisch, wie ich finde – lustig gemacht; für jemanden, der in Eisenhüttenstadt ausgewachsen ist, welches übrigens 1953 Karl-Marx-Stadt heißen sollte, dann jedoch den Namen Stalinstadt verliehen bekam, ein vertrauter Topos (geisteswissenschaftlich). Darüber hinaus erfindet Michael Gückel den in Chemnitz geborenen Dichter Hermann K. Tschunke und legt diesem folgende Worte in den Mund: »In Chemnitz zu leben ist, wie einer Pflaume beim Schimmeln zuzusehen.« Immer gut, wenn man seine Meinung mit einem Schriftsteller teilen kann. Für diesen subtilen Gag bekommt der Autor einen Extrapunkt.
Wie so etwas bei der überwiegend ostdeutschen Leserschaft ankommt, kann man in über 700 Kommentaren lesen. Die Reaktionen reichen von »Das ist keine Pressefreiheit sondern einfach alles nur Dreck!« (Wolfgang) über »Der Autor tut mir leid! Er sollte sich mehr überlegen, was er schreibt und Chemnitz mal zB. zur Adventszeit besuchen.« (M. Wünsch, Chemnitz) bis zu »die satire ist sehr gut und wer mit offenen augen durch die stadt geht weiss was damit gemeint ist.« (Iflashback). Hier vermute ich auch einen der eigentlichen Gründe, warum hin und wieder solche (allerdings dann ‚ernst‘) gemeinten Artikel in den seriösen Medien über den Osten erscheinen. Wer öffentlich Leute beleidigt, bekommt garantiert eine Reaktion. Wer eine ganze Stadt beleidigt, bekommt garantiert viele Reaktionen und somit Klicks auf seiner Seite. Doch darf das Journalismus? Um der Auflage wegen unsachlich werden? Ich dachte, das wäre allein die Domäne einer gewissen Boulevard-Zeitung. Doch zurück zum vorliegenden Artikel, denn der ist Satire. Am besten hat mir die Reaktion des Chemnitzverstehers gefallen, sie klingt so entspannt und warmherzig:
»Ich mag den Text. Und Chemnitz mag ich auch, obwohl es leer ist und alt und nach Vergangenheit riecht und nicht nach Zukunft. Satire darf natürlich Stalingrad-Witze machen (langweilige taz: paar Tage später gabs einen Stalingrad-Witz auf Kosten von NRW), sie darf auch über Verkehrstote lachen (solang dabei kein taz-Genosse umkam, die werden dringender gebraucht denn je). Und Satire darf natürlich auch keine Ahnung haben. Was wir als Chemnitzer nicht dürfen: Uns aufregen und so tun, als würden wir in Neu-Paris leben. Lachen wir doch einfach mal mit. So lachen alle, der Autor über sein Werk, die Berliner Leser über Chemnitz, wir Chemnitzer über den Autor und seine abgestandenen Witze und, denn dazu braucht es Reife, vielleicht auch über uns selbst und unsere absurde Stadt. Wir lieben Chemnitz, so wie wir unsere hässlichen Kinder lieben. Denen geben wir auch weiterhin alberne Namen, weil uns altdeutsche Dichtervornamen oder nordische Möbelnamen wirklich noch blöder erscheinen. Und nun geh ich raus und werde fest den Nischl drücken. War neulich in Berlin: Der Ernst-Thälmann am Ernst-Thälmann-Park in Prenzlauer Berg ist übrigens genauso groß und sieht dabei nicht annähernd so gut aus. Also, Chemnitzer: Bis dann am Nischel!« (Chemnitzversteher)
Dem ist nichts hinzuzufügen.
Foto: Kunst am Bau/DDR via flickr.com